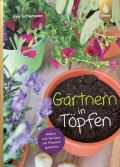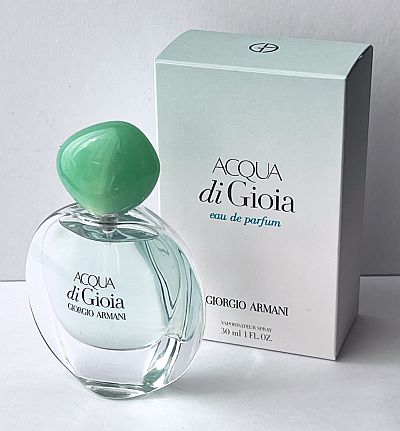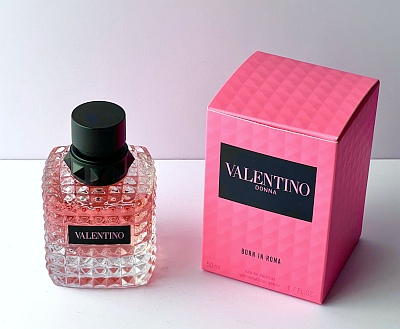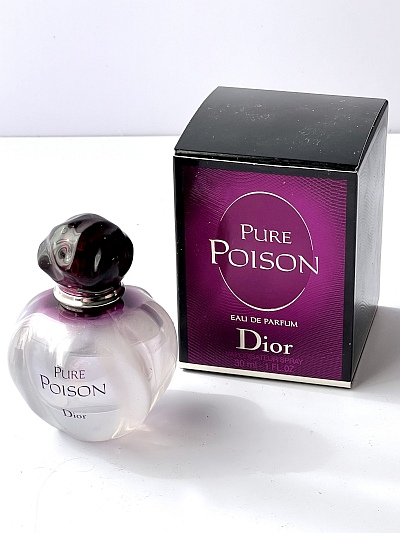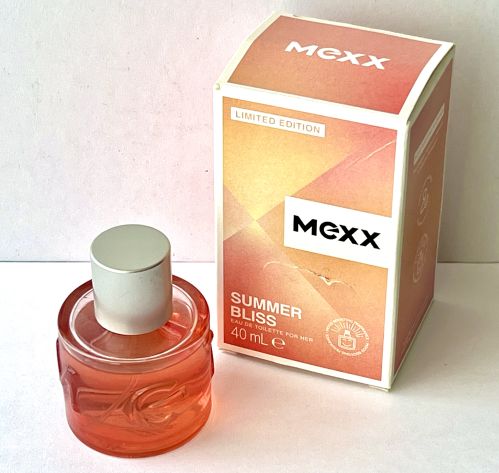(zuletzt aktualisiert am 19.09.2023)
Zu den Nützlingen im Garten zählen wir Igel,
Vögel, Bienen, Hummeln, Wildbienen, Marienkäfer, Florfliegen, Schwebfliegen, winzige Raubmilben und viele andere Lebewesen. Doch auch andere Lebewesen spielen eine wichtige Rolle in der Natur, aber sind gefährdet. Deshalb sollten wir unseren Beschützerinstinkt auch auf diese ausdehnen und am Erhalt der Artenvielfalt mitwirken. Ein paar Gedanken und Tipps zum Thema.
- Bienen und Wildbienen (Hummeln und andere) bestäuben Obstgehölze – ohne sie gäbe es keine Äpfel, Birnen, Johannisbeeren zu ernten,
- Igel vertilgen Schnecken,
- Vögel picken Insekten und deren Larven auf,
- Marienkäfer, Florfliegen, Schwebfliegen und andere halten Schädlinge wie Blattläuse, Weiße Fliege und Thripse in Schach und
- Raubmilben machen den Spinnmilben den Garaus.
Nützlinge sind also Tiere, die uns helfen, beispielsweise weil sie Blüten befruchten oder natürliche Gegenspieler der Schädlinge im Garten sind.
Nützlinge und Schädlinge
In Wahrheit gibt es in der Natur keine Guten und Bösen, sondern alles ist miteinander verflochten und beeinflusst sich gegenseitig. Bei Bienen sind sich alle einig, dass sie nützlich sind, aber was ist mit: Blattläusen, Käferlarven, Raupen und anderen? Zwar sind sie unsere „Nahrungskonkurrenz“, wenn es um unsere Gemüsepflanzen, Kräuter und Obst geht, aber ohne ausreichend viele Insekten können Vögel ihren Nachwuchs nicht ernähren, Marienkäfer würden verhungern, und ohne Raupen, die sich an Pflanzen laben, würden Schmetterlinge aussterben. Natürlich können wir Menschen uns nicht alles von Insekten oder anderen Lebewesen wegfressen lassen, aber trotz der theoretischen Möglichkeit, dass wir alles ausrotten könnten, was kreucht und fleucht, sollten wir so vernünftig sein, nur regulierend einzugreifen, wo tatsächlich gravierende Schäden (oft als Folge undurchdachter menschlicher Eingriffe) zu erwarten sind und wo man die Auswirkungen überschauen/begrenzen kann, aber ansonsten mit den Kreisläufen und Vernetzungen der Natur zusammenarbeiten.
Nützlinge im Garten und anderswo fördern
Nützlinge kann man überall fördern, wo man gärtnert: im Hausgarten, auf Balkon, Terrasse und Dachterrasse, in der Kleingartenanlage, im Urban-Gardening-Projekt (Gemeinschaftsgärten und andere gärtnerische Projekte in der Stadt und auf Industriebrachen). Damit sich Insekten zuhause fühlen, muss man diesen Lebewesen geeigneten Lebensraum, Nahrung für die verschiedenen Lebensstadien, Unterschlupf-, Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten bieten, statt wie früher jedes Insekt mit Gift zu bekämpfen oder den Garten pingelig rein für den Winter vorzubereiten – so ein Garten ist tot. Damit sich die Nützlinge oder andere Insekten verstecken und überwintern können, sollte man den Garten nicht blitzblank aufräumen, sondern Reisighaufen, Laubhaufen, Steinhaufen und Ähnliches liegen lässt (muss ja nicht gleich neben der Terrasse sein). Um die Tiere zu unterstützen, sät oder pflanzt man Gehölze, Stauden, Kräuter und Blumen, die Nützlingen etwas zu bieten haben – nämlich Pollen, Nektar, Speisepflanzen und/oder Verstecke. Bei der Pflanzenauswahl sollte man unbedingt auch heimische Pflanzen mit einbeziehen, denn auf diese sind viele Arten (auch inzwischen seltene Schmetterlinge) angewiesen.
Im Bild oben laben sich zwar die Hummeln an einer riesigen Sonnenblume, die vermutlich extra auf hohen Ertrag gezüchtet wurde, aber oft sind die einfachen Wildarten im Vergleich zu hochgezüchteten Sorten die besseren Nektar- und Pollenspender. Das bedeutet nicht, dass man nur noch Wildpflanzen oder botanische Arten pflanzen muss, aber zumindest einige Plätzchen sollte man für sie übrig haben – je mehr, desto besser. Wildarten haben zwar manchmal etwas weniger auffällige Blüten, aber dafür oft eine besondere Ausstrahlung und mancheine/r entwickelt sich regelrecht zum Liebhaber dieser teilweise vergessenen Schönheiten (die oft auch noch Heil- oder Wildgemüsepflanzen sind).
Frühblühende Pflanzen bieten Nützlingen und anderen Insekten das erste Futter
Frühblühende Pflanzen liefern das erste Futter im Frühjahr,
so beispielsweise die frühblühenden Blumenzwiebelblumen (Schneeglöckchen, Krokus, Traubenhyazinten, Blaustern etc.), Knollenblumen (wie der Winterling) und andere Stauden (wie Buschwindröschen, Christrose, Akelei, Blaukissen, Kaukasus-Vergissmeinnicht, Kriechender Günsel und viele andere). Sehr beliebt sind auch blühende Obstgehölze wie Kirsche, Apfel und Johannisbeeren mit ihrem Blütenreichtum – für viele Nützlinge ein Festschmaus.
Nützlinge und heimische Pflanzen sind oft ein „eingespieltes Team“
Sehr zu empfehlen für den Garten sind heimische Blühgehölze bzw. fruchttragende Gehölze, denn sie und die Nützlinge „arbeiten“ schon seit vielen Jahren zusammen. Als „wilde“ Gartengehölze – nicht nur zur Freude der Nützlinge – eignen sich beispielsweise:
 Gemeine Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
Gemeine Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
Berberitze Berberis vulgaris
Kornelkirsche (Cornus mas)
Haselnuss (Corylus avellana)
Ahorn-Arten Acer
Filzige Zwergmispel (Cotoneaster tomentosus)
Weißdorn (Crataegus)
Besenginster (Cytisus scoparius)
Spindelstrauch (Euonimus)
Färberginster (Genistra tinctoria)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Heckenkirsche (Lonicera caerulea)
Schlehe (Prunus spinosa)
Alpen-Johannisbeere, Blutjohannisbeere, Goldjohannisbeeere Ribes-Arten
Hunds-Rose (Rosa canina)
Rotblättrige Rose Rosa rubrifolia
 Sie können als Solitär, in Gruppen oder in einer ungeschnittenen gemischten Hecke gepflanzt werden – letztere hat allerdings einen hohen Platzbedarf. Das gilt erst recht für hohe Bäume, wie Erle und Weide, die auch gute Bienentrachtpflanzen im Frühjahr abgeben.
Sie können als Solitär, in Gruppen oder in einer ungeschnittenen gemischten Hecke gepflanzt werden – letztere hat allerdings einen hohen Platzbedarf. Das gilt erst recht für hohe Bäume, wie Erle und Weide, die auch gute Bienentrachtpflanzen im Frühjahr abgeben.
Nützlinge laben sich gerne an den Blüten von Kräutern

Blühende Kräuter im Gemüsegarten und vor dem Gewächshaus locken Nützlinge an.
Hervorragend dazu geeignet, Nützlinge in die Gemüsebeete oder in Kleingewächshäuser zu locken, sind blühende Kräuter, Gewürze und Heilpflanzen wie Thymian, Dill, Oregano, Borretsch, Ringelblume, Kamille und viele andere, die man in den Gemüsegarten bzw. in oder um das Gewächshaus pflanzt.

Blühender Thymian im Topfgarten ist wie eine „Tankstelle“ für Nützlinge
Anzeige
Weitere bei Nützlingen beliebte Pflanzen sind Duftsteinerich (Lobularia maritima), Steinkraut (Alyssum saxatile), Klatschmohn, Phacelia, Schafgarbe, Beinwell, Wegwarte, Wicken, Wilde Malve, Kornblume, Lavendel, Blauer Eisenhut, Glockenblume, Waldmeister, Purpur-Sonnenhut (Echinacea purpurea), Rosen, Schmetterlingsflieder (Buddleija davidii) und so weiter, aber auch so genanntes Unkraut im Rasenwie Löwenzahn, kriechender Günsel, Gundermann, Klee und viele andere.
* Werbelink/Affiliate-Link
Wenn Sie diesen Blog mit einer Spende unterstützen möchten: → „Kaffeekasse“ bei paypalme/eva4tinto. DANKE!
Das könnte Sie auch interessieren
- Herbstblüher für Bienen, Hummeln, Schwebfliegen, Schmetterlinge und viele andere (Blog: Gartensaison ist immer – Gartentipps…)
- Biologischer Pflanzenschutz im Garten
- Schnecken – und wie man Gartenpflanzen vor ihnen schützt (tinto bloggt)
(Balkon, Terrasse, Garten gestalten,
Blumen und Gemüse nach Saison oder als Dauerbepflanzung)
Eva Schumann
Ulmer Verlag, Stuttgart
ISBN 3-8186-0635-8
Taschenbuch, 128 Seiten